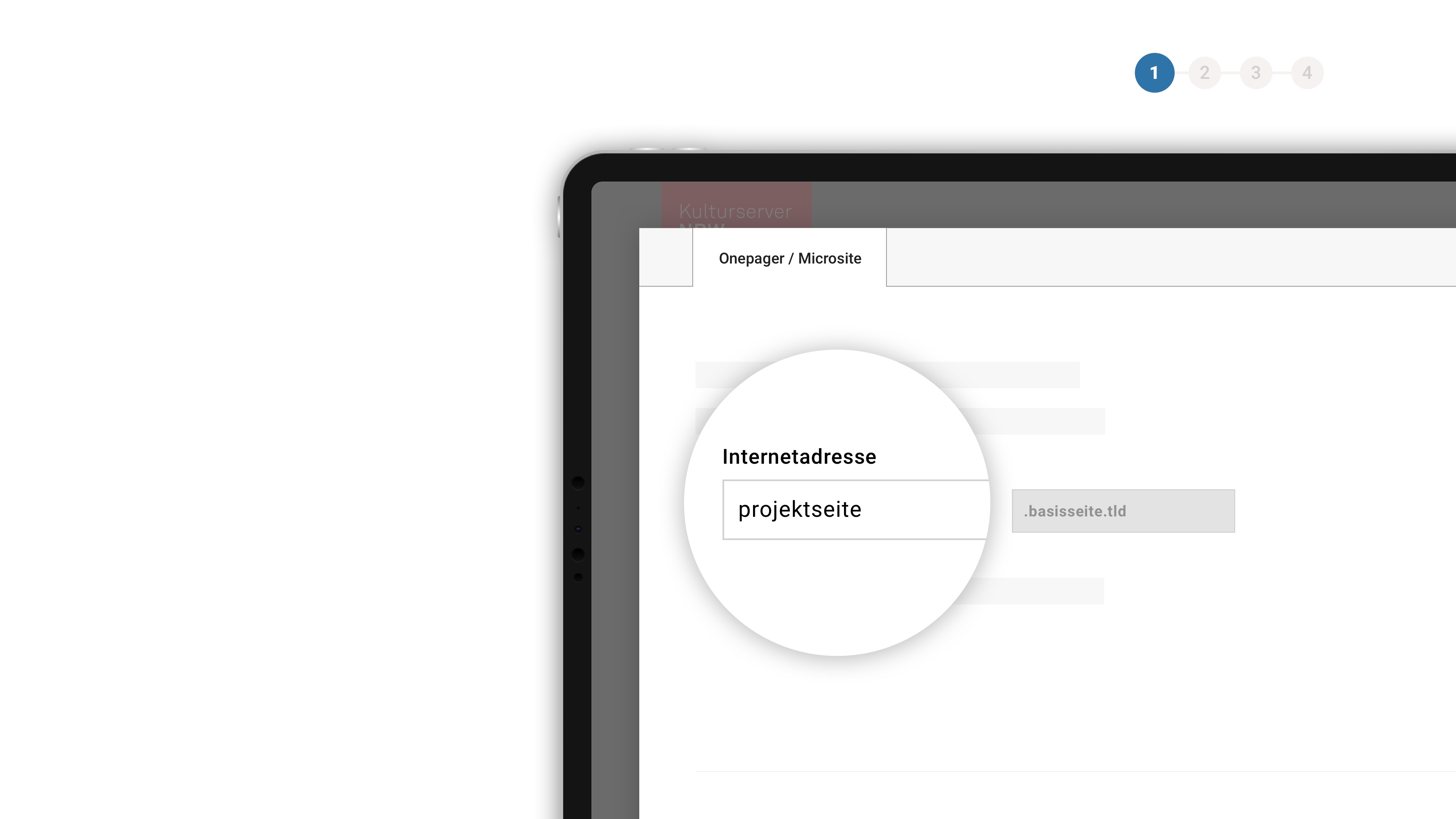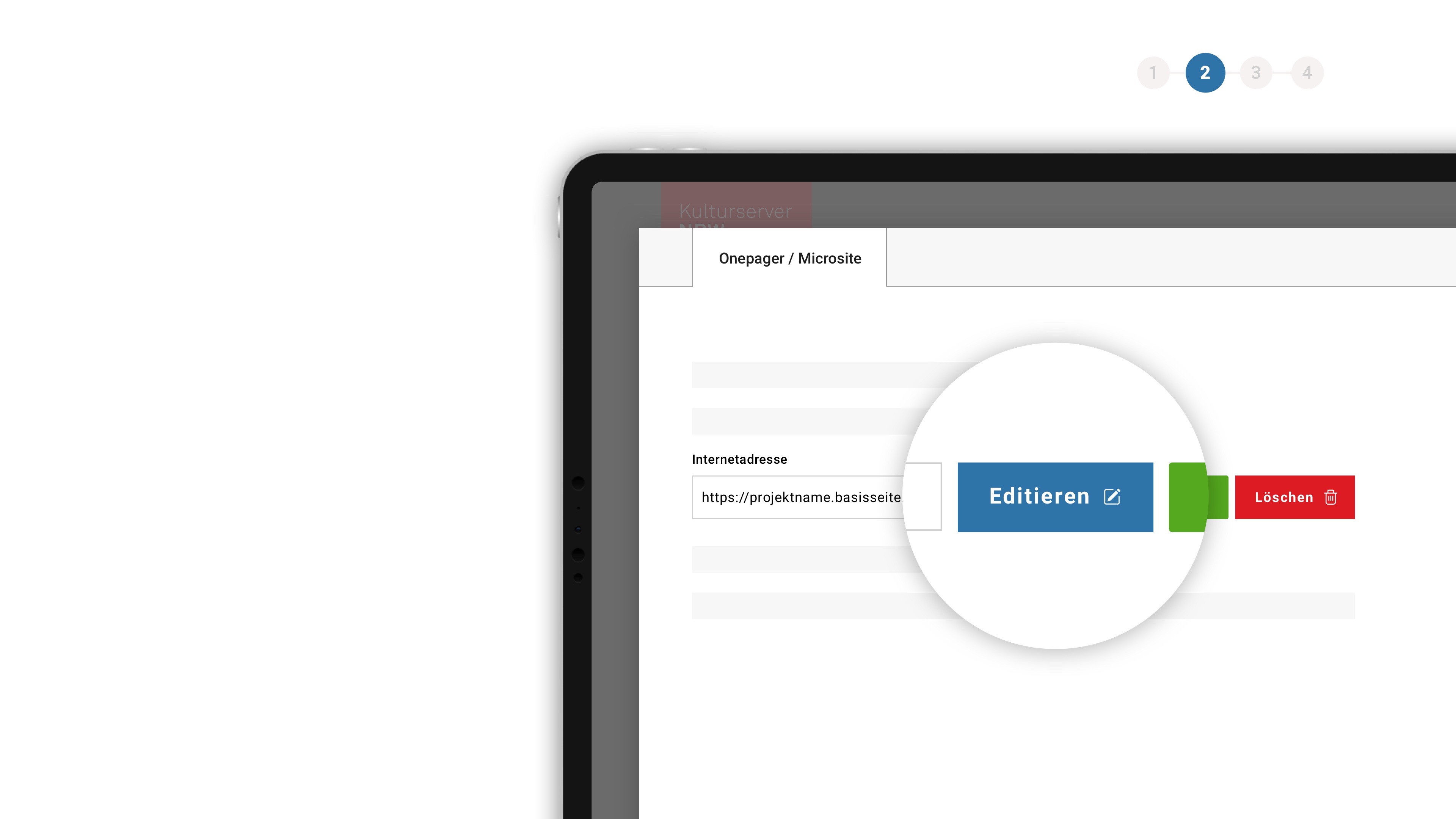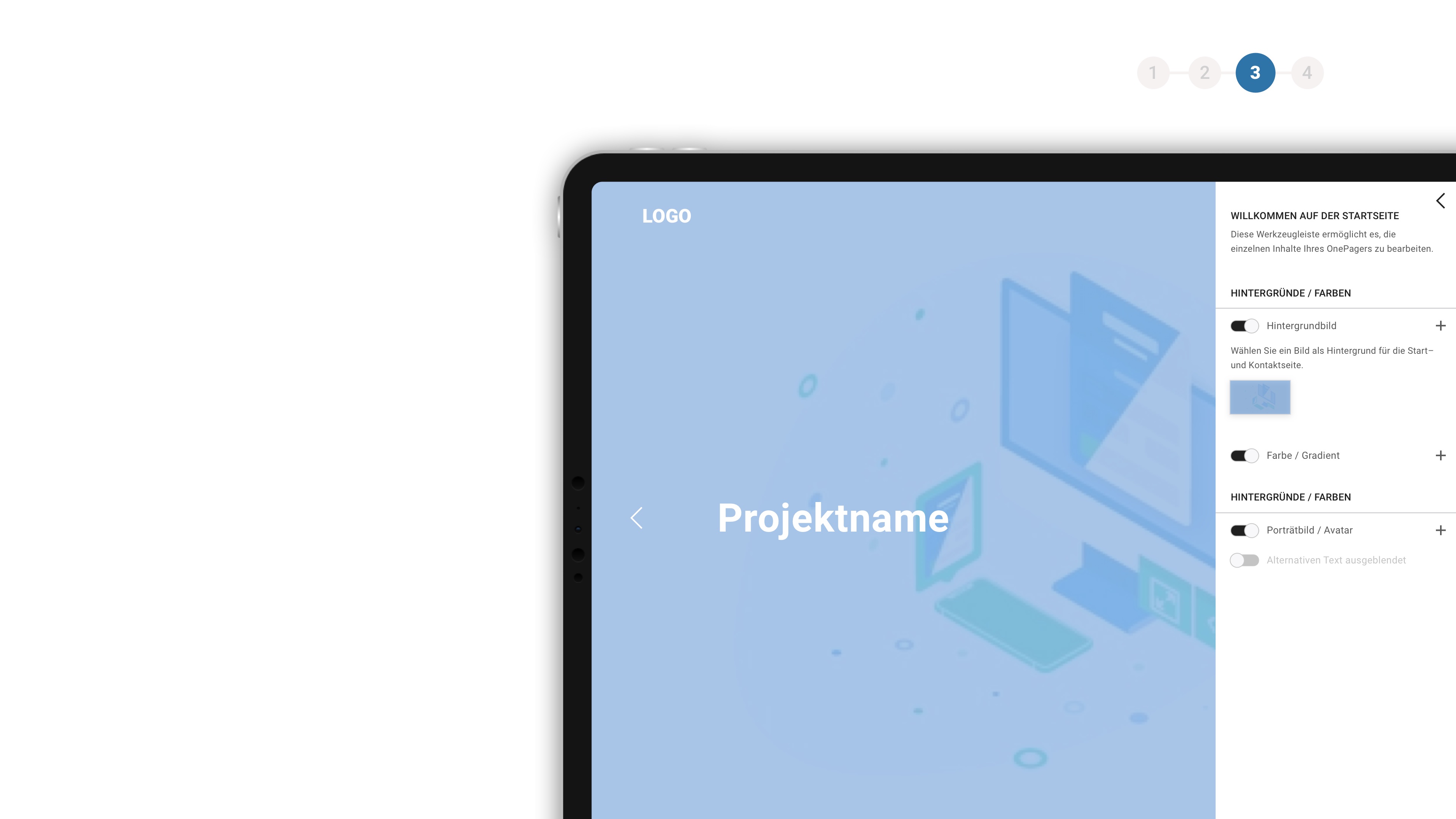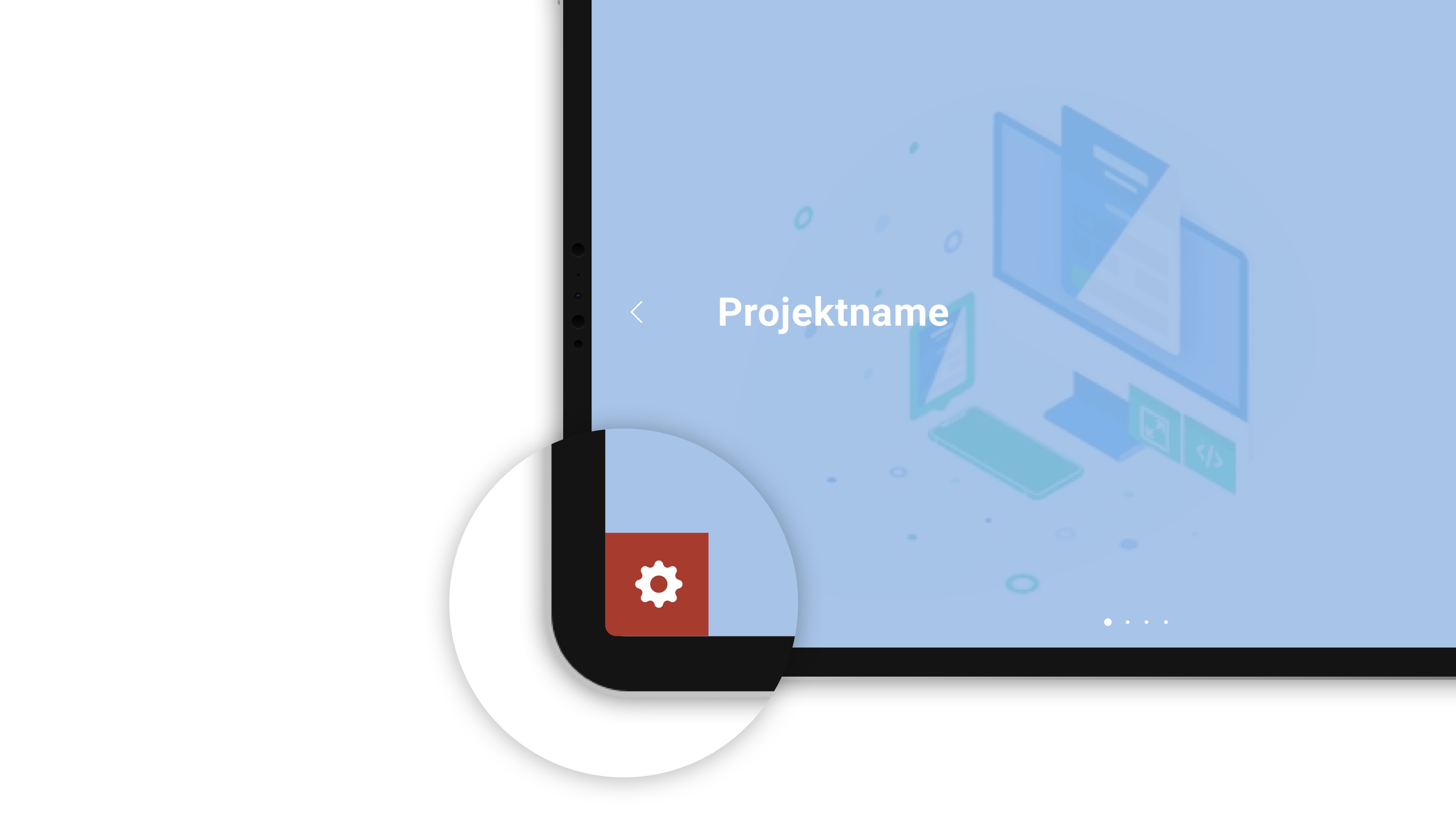Elektra
Richard Strauss [1864 – 1949]
„Bei allen Ausmaßen der Partitur ist ELEKTRA ein Kammerspiel. Es geht mir nicht um das Entwerfen von Schreckensbildern, sondern um die Fühlbarmachung des Horror vacui, in dem Menschen leben. Die Grenze zwischen Passion und Obsession ist gefährlich fließend. Das erleben wir jeden Tag in der Weltpolitik und im Alltag. An Elektra berührt mich die Unfähigkeit zu trauern. Sie hat sich die Trauer verboten und ihr Leben so gestaltet, dass keine Trauerarbeit mehr stattfinden kann. Tiefe und existenzielle Gefühle wie Schmerz brauchen ein Ventil. Wer trauern kann, muss nicht hassen. Das Erschütternde an ELEKTRA ist, welche verheerenden Ausmaße unhinterfragbare Verhaltensmuster annehmen können. Chrysothemis weiß um den Ausweg aus der Gewaltspirale, doch sie kann sich nicht gegen ihre Schwester durchsetzen und sie aus ihrer mentalen Gefangenschaft befreien. Während sich Elektra am Schluss in Spiegelwesen ihres verwüsteten Inneren spaltet, und sich ihre Persönlichkeit in einem Pandämonium eskalierender Emotionen verliert, bleibt Chrysothemis als einzige Überlebende der Sippe inmitten eines unentrinnbaren Palastes voll Phantomen zurück…“ (Kirsten Harms, 2007)
Mit Unterstützung des Förderkreises der Deutschen Oper Berlin e. V.
- Musikalische Leitung David Afkham
- Inszenierung
- Bühne, Kostüme
- Chöre
- Choreographie
- Klytämnestra Karita Mattila
- Elektra
- Chrysothemis
- Aegisth
- Orest
- Der Pfleger des Orest Jared Werlein
- Die Vertraute Hye-Young Moon
- Die Schleppträgerin Lucy Baker
- Ein junger Diener N. N.
- Ein alter Diener
- Aufseherin Maria Motolygina
- 1. Magd Stephanie Wake-Edwards
- 2. Magd Martina Baroni
- 3. Magd Arianna Manganello
- 4. Magd Maria Vasilevskaya
- 5. Magd Nina Solodovnikova
- Chor
- Orchester
- Tänzer

Veranstaltungsort
Deutsche Oper Berlin
Es war fast eine kleine Kulturrevolution, die Berlins Bürger wagten, als sie vor mehr als hundert Jahren im damals noch unabhängigen Charlottenburg die Deutsche Oper gründeten. Ein eigenes Opernhaus, das explizit auch dem modernen Musiktheater von Richard Wagner an geweiht sein sollte – das war ein klares Gegenmodell zur ehrwürdigen Hofoper Unter den Linden. Und noch dazu war der Bau an der Bismarckstraße ...